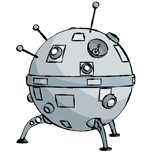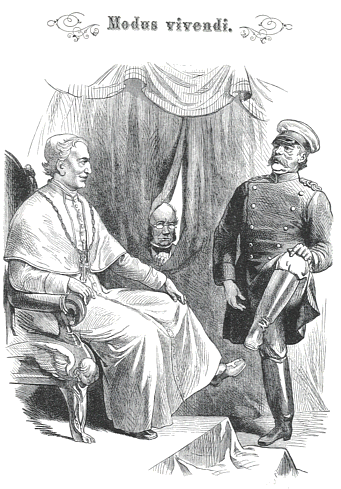Der Kulturkampf
Der Kulturkampf - kurz erklärt
Der Kulturkampf war ein politischer Konflikt im 19. Jahrhundert zwischen dem deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck und der katholischen Kirche. Bismarck wollte den Einfluss der Kirche auf den Staat verringern und führte Gesetze ein, um die Kontrolle über Schulen und kirchliche Ämter zu stärken. Der Konflikt endete später mit einem Kompromiss.
Was hat das Unfehlbarkeitsdogma mit dem Kulturkampf zu tun?
Das so genannte Unfehlbarkeitsdogma des Papstes aus dem Jahr 1870 führte zum Kulturkampf. Der Papst hatte in diesem Dogma erklärt, dass er im Namen aller Christen bestimmte Entscheidungen als endgültig entschieden treffen darf. Niemand sollte sie in Frage stellen. Bismarck gefiel dieser Machtanspruch des Papstes so gar nicht. Er wandte sich gegen den Einfluss der katholischen Kirche auf den Staat. Der Kampf richtete sich auch gegen die katholische Zentrumspartei.
Kulturkampf: Gesetze gegen die Kirche
Verschiedene Gesetze wie Kanzelparagraph (1871), Schulaufsichtsgesetz (1872) und Verbot des Jesuitenordens, Maigesetze (1873/74) mit Vorschriften des Staates bezüglich der Ausbildung von Geistlichen und die Einführung der Zivilehe, die vor dem Standesamt geschlossen werden musste (1874/1875), schränkten den Einfluss der katholischen Kirche ein.
Widerstand der Kirche
Als diese Reformen zum Widerstand der Kirche führten, wurde Bismarck am Ende doch zum Nachgeben gezwungen. Am Ende hob er einen großen Teil der Gesetze wieder auf. Staatliche Schulaufsicht und Zivilehe blieben allerdings erhalten. Somit waren diese ein Erfolg des Kulturkampfes.